Weitere Ergänzungen zur Textsammlung Aufruhr & Revolte
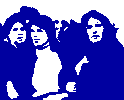

EXTRA-DOKUMENTATION
H. M. ENZENSBERGER: WARUM ICH DIE USA VERLASSE
Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger hat mit einem aufsehenerregenden Brief seinen Rücktritt von seiner Tätigkeit an der Wesleyan University im US-Staate Connecticut begründet. Enzensberger will jetzt in Cuba arbeiten. Der von EXTRA-Dienst im Wortlaut abgedruckte Brief erschien erstmals am 29. Februar 1968 in der amerikanischen Zeitschrift "The New Yorker Review of Books". Ins Deutsche übersetzt wurde der Brief von Bernward Vesper.
Verehrter Präsident, hiermit ersuche ich Sie, meinen Rücktritt als Mitarbeiter am Zentrum für Fortgeschrittene Studien der Wesleyan Universität zu genehmigen. Gleichzeitig möchte ich Ihnen so gut ich kann für die Gastfreundschaft danken, die Sie mir während meines Aufenthaltes hier erwiesen haben. Das Wenigste, was ich Ihnen, der Fakultät und den Studenten schulde, ist die Rechenschaft über die Gründe, die mich bewogen haben, Wesleyan zu verlassen.
Lassen Sie mich mit einigen grundsätzlichen Erwägungen beginnen. Ich halte die Klasse, die die USA beherrscht, und die Regierung, die ihr als Werkzeug dient, für die gefährlichste menschliche Gruppierung der Erde. Diese Klasse ist in der einen oder anderen Weise und in unterschiedlichem Grade eine Bedrohung eines jeden, der ihr nicht angehört. Sie führt gegen mehr als eine Milliarde Menschen einen nicht erklärten Krieg. Ihre Waffen reichen von Bombenteppichen bis zu den raffiniertesten Techniken der Verführung; ihr Ziel ist es, ihre politische, ökonomische und militärische Vorherrschaft über jede andere Macht der Welt zu errichten. Ihr Todfeind ist die revolutionäre Umwälzung. Viele Amerikaner sind vom Zustand ihrer Nation tief beunruhigt. Sie verwerfen den Krieg der in ihrem Namen gegen das vietnamesische Volk geführt wird. Sie suchen nach Mitteln und Wegen, um den latenten Bürgerkrieg in den Gettos der amerikanischen Städte zu beenden. Aber die meisten von ihnen halten an der Vorstellung fest, daß diese Krisen nur unglückliche Zufälle darstellen, die einem fehlerhaften Management, einem Mangel an Verständnis anzulasten sind: tragische Irrtümer einer im übrigen friedfertigen, vernünftigen, wohlwollenden Weltmacht.
Ich kann dieser Interpretation nicht zustimmen. Der Vietnamkrieg ist kein isoliertes Phänomen. Er ist der sichtbarste Ausdruck und gleichzeitig der blutigste Testfall einer kohärenten internationalen Politik, die fünf Kontinente überzieht. Die herrschende Klasse der Vereinigten Staaten hat Partei ergriffen in den bewaffneten Kämpfen in Guatemala und Indonesien, in Laos und Bolivien, in Korea und Kolumbien, auf den Philippinen und ii Venezuela, im Kongo und in der Dominikanischen Republik. Diese Liste ist nicht vollständig. Viele andere Länder werden mit amerikanischer Hilfe von Unterdrückung, Korruption und Hunger beherrscht. Niemand kann sich noch irgendwo sicher und beschützt fühlen, nicht in Europa, nicht einmal in den Vereinigten Staaten selbst.
An der einfachen Wahrheit, die ich hier feststelle, ist nichts Überraschendes oder Originelles. Ich habe hier nicht Raum, sie in wissenschaftlicher Weise zu begrenzen und zu differenzieren. Das haben andere, unter ihnen viele amerikanische Gelehrte wie Baran und Horowitz, Huberman und Sweezy, Zinn und Chomsky ausführlich getan. Soweit ich hier beobachten konnte, hält die akademische Gemeinschaft nicht viel von ihren Werken. Man hat sie als altmodisch, langweilig und rhetorisch bezeichnet, Ausgeburt paranoider Phantasie oder einfach als kommunistische Propaganda. Diese Verteidigungsmechanismen gehören zur Standardausrüstung westlicher Intellektueller. Da ich ihnen hier häufig begegnet bin, nehme ich mir die Freiheit, sie etwas näher zu untersuchen. Das erste Argument ist eine Angelegenheit der Semantik. Unsere Gesellschaft war in der Lage, die alten sprachlichen Tabus aufzuheben. Niemand wird mehr durch die altertümlichen und unerläßlichen schmutzigen Wörter geschockt. Gleichzeitig wurde eine neue Gruppe von Wörtern durch allgemeinen Konsensus aus der guten Gesellschaft verbannt: Wörter wie Ausbeutung und Imperialismus. Sie erhielten den Anstrich des Obszönen. Die Politik-Wissenschaftler haben ihre Zuflucht zu Paraphrasen und Umschreibungen genommen, die wie die neurotischen Euphemismen des viktorianischen Zeitalters klingen. Einige Soziologen sind soweit gegangen, die Existenz einer herrschenden Klasse überhaupt zu bestreiten. Es ist ganz offensichtlich einfacher, das Wort Ausbeutung abzuschaffen als die Sache, die es bezeichnet; aber den Terminus zu beseitigen heißt keinesfalls, das Problem beseitigen.
Eine zweite Verteidigungslist ist der Gebrauch der Psychologie als eines Schutzschildes. Man hat mir gesagt, es wäre krankhaft und paranoid, an eine mächtige Gruppe von Personen zu glauben, die für die übrige Welt eine Gefahr darstellt. Das läuft darauf hinaus, daß man besser daran tut, den Patienten zu bewachen als seinen Argumenten zu folgen. Nun ist es nicht einfach, sich gegen Amateur-Psychiater zu verteidigen. Ich muß mich auf einige wesentliche Punkte beschränken. Ich stelle mir keine Verschwörung vor, weil es ihrer gar nicht bedarf. Eine soziale Klasse und besonders eine herrschende Klasse wird nicht durch geheime Bande zusammengehalten, sondern durch das gemeinsame und völlig offensichtliche Eigeninteresse. Ich fabriziere keine Monster. Jeder weiß, daß Bankpräsidenten, Generäle und Rüstungsindustrielle nicht wie Comic-Strip-Dämonen aussehen: sie sind wohlerzogene, nette Herren, möglicherweise Liebhaber von Kammermusik mit philanthropischen Neigungen. An solchen Leuten war selbst im Deutschland der Dreißiger Jahre kein Mangel. Ihr moralischer Wahnsinn leitet sich nicht von ihrem individuellen Charakter her, sondern von ihrer sozialen Funktion.
Schließlich gibt es einen politischen Verteidigungsmechanismus, der mit der Behauptung operiert, daß alle Dinge, die ich vorlege, einfach kommunistische Propaganda sind. Ich habe keinen Anlaß, diesen altehrwürdigen Vorwurf zu fürchten. Er ist unscharf, vage und irrational. Erstens ist das Wort Kommunismus als Singular fast inhaltslos geworden. Es bezeichnet eine große Vielzahl von widerstreitenden Ideen, von denen sich einige sogar gegenseitig ausschließen. Darüber hinaus wird meine Einschätzung der amerikanischen Außenpolitik von griechischen Liberalen und lateinamerikanischen Erzbischöfen, von norwegischen Bauern und französischen Industriellen geteilt: Leuten, von denen man im allgemeinen nicht annimmt, daß sie zur Avantgarde des "Kommunismus" gehören. Tatsächlich haben die meisten Amerikaner keine Ahnung, wie sie und ihr Land der Welt draußen erscheinen. Ich habe die Blicke gesehen, die ihnen folgen: den Touristen in den Straßen Mexicos, den Soldaten auf Urlaub in fernöstlichen Städten, den Geschäftsleuten in Italien oder Schweden. Der gleiche Blick gilt ihren Botschaftern, ihren Zerstörern, ihren Plakaten in der ganzen Welt. Es ist ein furchtbarer Blick, weil er keine Differenzierung und keine Anerkennung enthält. Ich will ihnen sagen, warum ich diesen Blick wiedererkenne: weil ich ein Deutscher bin. Weil ich ihn auf mir selbst gefühlt habe.
Wenn man versucht, ihn zu analysieren, wird man eine Mischung von Mißtrauen und Ressentiment, von Angst und Neid, von Verachtung und direktem Haß entdecken. Er trifft Ihren Präsidenten, für den es wohl kaum noch eine Hauptstadt in der Welt gibt, wo er sein Gesicht in aller Öffentlichkeit zeigen kann; aber er trifft auch die nette alte Lady auf dem Nebensitz beim Flug von Delhi nach Benares. Es ist ein unterschiedsloser, ein manichäischer Blick. Ich liebe ihn nicht. Ich teile nicht den Glauben Ihres Präsidenten an Kollektivurteile und Kollektivschuld. "Vergeßt nicht", sagte er seinen Soldaten in Korea, "wir sind nur 200 Millionen in einer Welt von drei Milliarden. Sie wollen das haben, was wir besitzen, und wir sind nicht bereit, es ihnen zu geben". Nun ist es vollkommen wahr, daß wir alle einen gewissen Anteil an der Ausbeutung der Dritten Welt nehmen. Wirtschaftswissenschaftler wie Dobb und Bettelheim, Jalee und Robinson haben genügend Beweise für die Tatsache erbracht, daß die armen Länder, die wir zu unterentwickelten machen, unsere eigenen Ökonomien subventionieren. Aber Mr. Johnson überschätzt bestimmt seine Position, wenn er voraussetzt, daß das amerikanische Volk ein einziger, gut organisierter Riese wäre, der für seine Beute kämpft. Mehr als das Auge Johnsons wahrnimmt, ist an Amerika zu bewundern. Ich finde in Europa wenig, was sich mit dem Kampf vergleichen ließe, den die Leute von SNCC, vom amerikanischen SDS oder der Verweigerungskampagne führen. Und ich darf hinzufügen, daß ich die Miene des moralisch Überlegenen, die viele Europäer gegenüber den USA zur Schau stellen, unangebracht finde. Sie scheinen es sich als ihr persönliches Verdienst auszurechnen, daß ihre eigenen Imperien zerrüttet worden sind. Das ist natürlich ein hypokritischer Unsinn. Es gibt jedoch eine Art politischer Verantwortung für das, was das eigene Land der übrigen Welt antut. Die Deutschen haben das zu ihrem eigenen Leidwesen nach den beiden Weltkriegen gemerkt. Die Lage Ihrer Union erinnert mich in mehr als einer Hinsicht an die Lage meines eigenen Landes Mitte der Dreißiger Jahre. Ehe Sie diesen Vergleich zurückweisen, bedenken Sie bitte, daß zu diesem Zeitpunkt noch niemand an Gaskammern gedacht oder von ihnen gehört hatte; daß respektable Staatsmänner Berlin besuchten und dem Reichskanzler die Hand schüttelten; und daß die meisten Leute sich weigerten zu glauben, daß Deutschland darauf ausginge, die Welt zu beherrschen. Natürlich konnte jeder beobachten, daß es Rassendiskriminierung und Rassenverfolgung gab; der Rüstungsetat verzeichnete eine alarmierende Zuwachsrate; und die Einmischung in den Krieg gegen die spanische Revolution nahm ständig zu.
Aber hier versagt meine Analogie. Unsere augenblicklichen Herren verfügen nicht nur über Zerstörungskräfte, von denen die Nazis nicht einmal träumen konnten; sie haben auch einen Grad von Gerissenheit und Fälschung erreicht, der in der alten rohen Zeit unbekannt gewesen ist. Opposition, die sich auf Worte beschränkt, läuft heutzutage Gefahr, zu einem unschädlichen Showgeschäft zu werden, das lizenziert, genau geregelt und bis zu einem gewissen Grade sogar von den Mächtigen ermutigt wird. Die Universitäten sind zu einem bevorzugten Schauplatz dieses zweideutigen Spiels geworden. Natürlich könnte nur ein Dogmatiker der übelsten Sorte behaupten, daß Zensur und offene Unterdrückung der unsicheren und täuschenden Freiheit, deren wir uns jetzt erfreuen, vorzuziehen wären. Aber andererseits kann nur ein Narr leugnen, daß eben diese Freiheit neue Alibis, Fallgruben und Dilemma für diejenigen erzeugt, die gegen das System opponieren. Ich habe drei Monate gebraucht, um herauszufinden, daß die Vorteile, die Sie mir gewähren, mich letztenendes entwaffnen werden; daß ich meine Glaubwürdigkeit dadurch verloren habe, daß ich Ihre Einladung und Ihr Stipendium annahm und daß die einfache Tatsache, daß ich unter diesen Bedingungen mich hier aufhalte, entwerten wird, was immer ich zu sagen hätte. "Wenn man einen Intellektuellen beurteilen will, reicht es nicht aus, seine Ideen zu untersuchen; es ist die Beziehung zwischen seinen Ideen und seiner Praxis, die zählt." Dieser Hinweis, den Regis Debray erteilte, bezieht sich im gewissen Sinn auf meine augenblickliche Situation. Um deutlich zu machen, daß ich meine, was ich sage, muß ich ihr ein Ende bereiten.
Das ist ein notwendiger, aber wohl kaum ausreichender Akt. Denn es ist eine Sache, den Imperialismus in allem Komfort zu studieren, und eine ganz andere, ihm dort entgegenzutreten, wo er ein weniger wohlwollendes Gesicht zeigt. Ich bin gerade von einer Reise nach Cuba zurückgekommen. Ich sah die Agenten des CIA auf dem Flughafen von Mexiko City, die von jedem, der nach Havanna fliegt, ein Photo machen; ich sah die Silhouetten der amerikanischen Kriegsschiffe vor der kubanischen Küste; ich sah die Spuren der amerikanischen Invasion in der Schweinebucht; ich sah das Erbe der imperialistischen Ökonomie und die Narben, die sie im Körper und im Geist eines kleinen Landes hinterlassen hat; ich sah die tägliche Belagerung, die die Kubaner zwingt, jeden einzelnen Löffel aus der Tschechoslowakei und jeden Liter Benzin aus der Sowjetunion zu importieren, weil die Vereinigten Staaten seit nun sieben Jahren versuchen, ein kleines Land auszuhungern und zur Kapitulation zu zwingen.
Ich habe mich entschieden, nach Cuba zu gehen und dort geraume Zeit zu arbeiten. Das bedeutet für mich kaum ein Opfer; ich fühle einfach, daß ich vom kubanischen Volk mehr lernen und daß ich ihm von größerem Nutzen sein kann als jemals den Studenten von der Wesleyan Universität.
Dieser Brief ist eine dürftige Art, Ihnen für Ihre Gastfreundschaft zu danken, und ich bedaure sehr, daß das alles ist, was ich als Gegengabe für drei friedliche Monate anzubieten habe. Ich weiß natürlich, daß mein Fall, für sich genommen, für die Außenwelt weder von Bedeutung noch von Interesse ist. Jedoch betreffen die Fragen, die er aufwirft, nicht mich allein. Erlauben Sie deshalb, daß ich sie, so gut ich vermag, öffentlich beantworte.
Ihr sehr ergebener Hans Magnus Enzensberger
Quelle: Berliner Extra-Dienst, 2.3.1968, Nr. 18, 2. Jhg.
OCR-scan red. trend
Editorische Anmerkung:
"1967
Fellow am Center for Advanced Studies der Wesleyan University,
Connecticut, USA. 1968
Aufgabe der Fellowship. Reise in den Fernen Osten."
Solche oder ähnlich dürre Informationen finden sich im Netz über H.M.
Enzensberger, wenn es um "68" und seine damalige Haltung zum
US-Imperialismus geht.
So z.B. bei